Interview mit Ildikó von Kürthy
 Ildikó von Kürthy im Interview
Ildikó von Kürthy im Interview
Ildikó von Kürthy arbeitet als Journalistin, ist Kolumnistin der Zeitschrift „Brigitte“ und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Hamburg. Ihre Bestseller wurden mehr als sechs Millionen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt. Die ehemalige „Stern“-Redakteurin ist Spezialistin für kluge, humorvolle und warmherzige Unterhaltung. „Es wird Zeit“ ist ihr neunter Roman, ein wunderbares Buch, in dem Wahrheit und Witz, Tiefgang und Leichtigkeit auf engstem Raum zusammenfinden.
Liebe Frau von Kürthy,
Sie sind eine sehr gefragte Schriftstellerin und Journalistin, weshalb wir uns umso mehr bei Ihnen bedanken möchten, dass Sie sich für unsere „besonderen Kinder“ – wie wir die Kinder mit Handicap nennen – Zeit genommen haben.
Durch die Blindheit Ihres Vaters mussten oder wollten Sie bereits früh Verantwortung übernehmen. Hat diese Erfahrung Ihre Sichtweise auf Menschen mit Handicap im Laufe Ihres Lebens verändert?
Für mich war der blinde Vater Normalität. Bis heute empfinde ich eine – womöglich etwas unangebrachte – freundliche Melancholie, wenn ich einem blinden Menschen begegne. Blindheit gehörte zu meinem Leben und ist Teil einer Menge guter Erinnerungen an meine Kindheit. Ich habe die meisten meiner Ferien in Kriegsblindenkurheimen verbracht – und das ausgesprochen gern. Mein Vater war sehr selbstständig, ein beeindruckender, vitaler Mann, Hochschulprofessor, gefragter Redner und intensiver Zuhörer. Es mag sein, dass ich durch mein Aufwachsen mit diesem blinden Vater eine, ich bitte das nicht abwertend zu verstehen, geradezu pragmatische Einstellungen gegenüber körperlichen Handicaps entwickelt habe. Natürlich berühren die besonderen Kinder mein Herz und ich bin voller Mitgefühl – aber gleichzeitig habe ich von klein auf miterlebt, wie erfüllend und glücklich das Leben von Menschen mit Behinderung sein kann.
Sie werden als gute Beobachterin beschrieben und sind Mutter von zwei Söhnen. Wenn Sie sich unser Schulsystem und unsere Gesellschaft anschauen, was würden Sie in Bezug auf Integration und Inklusion verändern wollen?
Da bin ich ehrlichgesagt völlig überfragt. Integration halte ich für eine wichtige Selbstverständlichkeit. Über die Erfolge und Konzepte der Inklusion weiß ich nicht genug. Ich kenne kluge Pädagogen, die glauben, mit Inklusion sei niemandem gedient und ebenso viele, die sie für richtig und wichtig halten. Das zu beurteilen überlasse ich Experten und Betroffenen.
 In Ihrem zuletzt erschienenen Buch „Es wird Zeit“ ist Ihre Freundin Jutta ein großes Thema, die an einem Pankreaskarzinom erkrankt ist und die Sie in einigen Lebenssituationen begleitet haben. Viele Menschen sind unsicher im Umgang mit einer lebenslimitierenden Diagnose eines nahestehenden Menschen und den daraus resultierenden Behandlungen. Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen?
In Ihrem zuletzt erschienenen Buch „Es wird Zeit“ ist Ihre Freundin Jutta ein großes Thema, die an einem Pankreaskarzinom erkrankt ist und die Sie in einigen Lebenssituationen begleitet haben. Viele Menschen sind unsicher im Umgang mit einer lebenslimitierenden Diagnose eines nahestehenden Menschen und den daraus resultierenden Behandlungen. Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen?
Es gibt keinen guten, keinen einzig richten Weg damit umzugehen, wenn das Schicksal zuschlägt oder man Zeuge wird, wie das Leben eines geliebten Menschen bedroht oder gar zerstört wird. Jeder Leidende ist anders und jeder Mitleidende auch. Was mir hilft ist Sprache und Gemeinschaft. Mir tut es wohl, über das Grauen zu sprechen – es zu analysieren, genau kennenzulernen, sich den Schmerz vertraut zu machen, er ist schließlich Teil von einem selbst. Meine erkrankte Freundin ist eine außerordentlich kluge und großherzige Frau, die sich nicht verschlossen, sondern auch denen, die ihr nahestehen die Möglichkeit gegeben hat, an ihrem Leid und übrigens auch ihrem Glück teilzuhaben. Das war ein Geschenk für mich, Mut machend und vorbildhaft.
Das Leben schlägt manchmal Haken und ist nicht immer planbar. Unser Magazin Momo ist für Eltern und Kinder, die besonders sind. Es soll nicht nur Mut machen und zeigen, was im Alltag alles möglich ist, sondern auch Eltern und Betroffenen die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen. Betroffene Eltern für Eltern! Was würden Sie unseren kleinen und großen Lesern mit auf den Weg geben?
Ich empfinde mich nicht als Ratgeberin oder gar Expertin in Sachen Lebensbewältigung. Ich sehe ein Geben und Nehmen und bin selbst immer wieder am Rande der Verzweiflung und auf der Suche nach Zuversicht. Was mir hilft, ist die Konzentration auf die Gegenwart und die aufrichtige Analyse der Vergangenheit. Die Zukunft wird überbewertet – zumindest die Gedanken und Sorgen, die man sich über sie macht. Ich finde es wichtig, viel Energie in einen gelungenen Alltag zu stecken und die Wahrnehmung für Dankbarkeit im Kleinen zu schulen.
Vielen herzlichen Dank für dieses Interview!
Martina Lange
Fotos: ©Jan Rickers, Buchcover_siehe Verlag


 Kreuzfahrtfeeling im Fränkischen Seenland
Kreuzfahrtfeeling im Fränkischen Seenland Eingebettet zwischen Altmühl und Donau liegt die Altstadt der Herzogstadt Kelheim, die bis in den letzten Pflasterstein voller Geschichte steckt. Das imposante Wahrzeichen der Stadt, die von König Ludwig I. erbaute Befreiungshalle, thront hoch oben auf dem Michelsberg. Von dort genießt man einen traumhaften Ausblick über die Stadt und das Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge“ mit dem berühmten Donaudurchbruch. Mit der Ludwigsbahn, einem Mini-Zug, gelangt man von der Befreiungshalle zur Schiffsanlegestelle an der Donau. Hier legen die barrierefreien Ausflugsschiffe zu ihrer Fahrt durch den Donaudurchbruch mit seinen spektakulären Felswänden ab. Im Kloster Weltenburg angekommen, laden die Klosterschenke und der Biergarten zu einer Stärkung mit bayerischen Schmankerln ein. Die Klosterbrauerei ist weltweit die älteste ihrer Art und die von den berühmten Gebrüdern Asam erbaute Klosterkirche zählt zu den bedeutendsten Barockkirchen Europas. Wanderfreudige können den Weg von Kelheim zum Kloster Weltenburg auf einem kinderwagengerechten Weg entlang der Donau und durch schattige Wälder zurücklegen.
Eingebettet zwischen Altmühl und Donau liegt die Altstadt der Herzogstadt Kelheim, die bis in den letzten Pflasterstein voller Geschichte steckt. Das imposante Wahrzeichen der Stadt, die von König Ludwig I. erbaute Befreiungshalle, thront hoch oben auf dem Michelsberg. Von dort genießt man einen traumhaften Ausblick über die Stadt und das Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge“ mit dem berühmten Donaudurchbruch. Mit der Ludwigsbahn, einem Mini-Zug, gelangt man von der Befreiungshalle zur Schiffsanlegestelle an der Donau. Hier legen die barrierefreien Ausflugsschiffe zu ihrer Fahrt durch den Donaudurchbruch mit seinen spektakulären Felswänden ab. Im Kloster Weltenburg angekommen, laden die Klosterschenke und der Biergarten zu einer Stärkung mit bayerischen Schmankerln ein. Die Klosterbrauerei ist weltweit die älteste ihrer Art und die von den berühmten Gebrüdern Asam erbaute Klosterkirche zählt zu den bedeutendsten Barockkirchen Europas. Wanderfreudige können den Weg von Kelheim zum Kloster Weltenburg auf einem kinderwagengerechten Weg entlang der Donau und durch schattige Wälder zurücklegen.

 Als eine der ersten Pilotdestinationen von „Reisen für Alle“ in Bayern verfügt das ARBERLAND Bayerischer Wald über vielfältige Ausflugsziele und Unterkünfte, die als barrierefrei zertifiziert wurden. Der waldreichste Landkreis in Bayern bietet mit dem Nationalpark Bayerischer
Als eine der ersten Pilotdestinationen von „Reisen für Alle“ in Bayern verfügt das ARBERLAND Bayerischer Wald über vielfältige Ausflugsziele und Unterkünfte, die als barrierefrei zertifiziert wurden. Der waldreichste Landkreis in Bayern bietet mit dem Nationalpark Bayerischer

 Interaktive Shutterbrille ersetzt Klebepflaster
Interaktive Shutterbrille ersetzt Klebepflaster Oft gehört und selten gesehen. Wie funktioniert eigentlich eine
Oft gehört und selten gesehen. Wie funktioniert eigentlich eine 
 50 Milligramm pro Liter Wasser – das ist der Grenzwert für Nitrat im Grund- und Oberflächenwasser in Europa. In Deutschland überschreiten jedoch 28 Prozent der Messstellen diesen Wert. Gelangt das Nitrat in unser Trinkwasser, kann das zum einen die Gesundheit schädigen, besonders bei Säuglingen und Kleinkindern. Zum anderen hat diese Menge an Nitrat im Wasser gravierende Auswirkungen auf die Natur.
50 Milligramm pro Liter Wasser – das ist der Grenzwert für Nitrat im Grund- und Oberflächenwasser in Europa. In Deutschland überschreiten jedoch 28 Prozent der Messstellen diesen Wert. Gelangt das Nitrat in unser Trinkwasser, kann das zum einen die Gesundheit schädigen, besonders bei Säuglingen und Kleinkindern. Zum anderen hat diese Menge an Nitrat im Wasser gravierende Auswirkungen auf die Natur. Duschgel, Zahnpasta, Lippenstift – in vielen Kosmetikprodukten steckt noch immer Mikroplastik. Die winzigen Plastikpartikel gelangen über das Abwasser in die Umwelt und richten dort unabsehbare Schäden an.
Duschgel, Zahnpasta, Lippenstift – in vielen Kosmetikprodukten steckt noch immer Mikroplastik. Die winzigen Plastikpartikel gelangen über das Abwasser in die Umwelt und richten dort unabsehbare Schäden an. MyoCamp 2019. Auf den Spuren der Indianer
MyoCamp 2019. Auf den Spuren der Indianer Das diesjährige Myo-Training stand unter dem Motto „Auf den Spuren der Indianer“. Das Bildungszentrum in Brannenburg am Fuße des Wendelsteins stellte sich mit seinem Panorama-Bergblick als optimaler Veranstaltungsort heraus. Im Mittelpunkt des Camps stand das gemeinsame Basteln, das die Feinmotorik der Kinder trainieren sollte. In diesem Rahmen entstanden Steckenpferde, Indianergewänder, Federschmuck, ein Marterpfahl und bunte Indiacas, mit denen die kleinen Indianer ihre Treffsicherheit üben konnten.
Das diesjährige Myo-Training stand unter dem Motto „Auf den Spuren der Indianer“. Das Bildungszentrum in Brannenburg am Fuße des Wendelsteins stellte sich mit seinem Panorama-Bergblick als optimaler Veranstaltungsort heraus. Im Mittelpunkt des Camps stand das gemeinsame Basteln, das die Feinmotorik der Kinder trainieren sollte. In diesem Rahmen entstanden Steckenpferde, Indianergewänder, Federschmuck, ein Marterpfahl und bunte Indiacas, mit denen die kleinen Indianer ihre Treffsicherheit üben konnten.
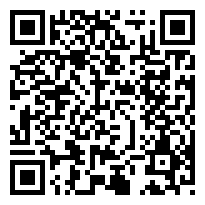
 DREI Weltmeister aus Deutschland
DREI Weltmeister aus Deutschland Besonders herausragend waren jedoch vor allem die Leistungen der Teilnehmer unter 16 Jahren. Während Til Augustin, deutscher Meister 2018 in D5 und 2019 in D3, gegen seine beiden Konkurrenten bei den Fortgeschrittenen in Division 4 gewann, setzte sich der achtjährige Tom Brimacombe in der Kids Division (D5) gegen sieben weitere Starter aus dem In- und Ausland durch und gewann die Weltmeisterschaft.
Besonders herausragend waren jedoch vor allem die Leistungen der Teilnehmer unter 16 Jahren. Während Til Augustin, deutscher Meister 2018 in D5 und 2019 in D3, gegen seine beiden Konkurrenten bei den Fortgeschrittenen in Division 4 gewann, setzte sich der achtjährige Tom Brimacombe in der Kids Division (D5) gegen sieben weitere Starter aus dem In- und Ausland durch und gewann die Weltmeisterschaft. Der Fachbereich WCMX sowie der gesamte DRS sind als Veranstalter stolz auf diese gelungene Meisterschaft, die den Zuschauern harte Wettkämpfe mit atemberaubenden Tricks, großartigen sportlichen Leistungen aller Teilnehmer und einer ausgelassenen Stimmung bot. Diese Stimmung wurde nach den Wettkämpfen an beiden Tagen in das Veranstaltungszelt getragen, wo alle noch gemeinsam bei den Partys feierten.
Der Fachbereich WCMX sowie der gesamte DRS sind als Veranstalter stolz auf diese gelungene Meisterschaft, die den Zuschauern harte Wettkämpfe mit atemberaubenden Tricks, großartigen sportlichen Leistungen aller Teilnehmer und einer ausgelassenen Stimmung bot. Diese Stimmung wurde nach den Wettkämpfen an beiden Tagen in das Veranstaltungszelt getragen, wo alle noch gemeinsam bei den Partys feierten. R82 „Flamingo High-low“
R82 „Flamingo High-low“
 Unzertrennliche Bande und herausfordernder Alltag.
Unzertrennliche Bande und herausfordernder Alltag. „Challenge Weeks“ an Schulen: Förderung per Fahrrad
„Challenge Weeks“ an Schulen: Förderung per Fahrrad Schweden
Schweden
 Weihnachten in Schweden
Weihnachten in Schweden Weihnachten in Südafrika
Weihnachten in Südafrika