Faszination Wasser – See, Meer und Ozean
 Faszination Wasser – See, Meer und Ozean
Faszination Wasser – See, Meer und Ozean
Die Erde wird auch der „Blaue Planet“ genannt. Dies ist verständlich, wenn man sich mal genau anschaut, wie viel Wasser es auf der Erde gibt. Nur 29 % der Erdoberfläche wird von Landflächen eingenommen – dagegen sind 71 % mit Wasser bedeckt. Ein Alleinstellungsmerkmal: Die Erde ist vermutlich der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem es flüssiges Wasser gibt. Im Wasser entstand das Leben und auch für uns Menschen ist es lebenswichtig. Doch woher kommt das Wasser auf der Erde eigentlich?
Wie es auf unseren Planeten gelangte, ist noch nicht klar, aber es gibt zwei Hypothesen: Der ersten zufolge enthielt der Planet von Anfang an Wasser. Es kann aber auch von Meteoroiden oder Kometen stammen, die auf die Erde stürzten. Als am wahrscheinlichsten gilt die Herkunft von Asteroiden, die jenseits des Mars um die Sonne kreisten.
Was ist ein Ozean?
Ein Ozean ist laut Lexikon eine große, zusammenhängende Wasserfläche zwischen den Kontinenten, die auch den Namen Weltmeer trägt – fünf dieser Ozeane gibt es: den Pazifischen Ozean (Pazifik), den Atlantischen Ozean (Atlantik), den Indischen Ozean (Indik), den Arktischen und den Antarktischen Ozean.
Was ist ein Meer?
Neben den Ozeanen gibt es ungefähr 80 Meere. Sie umfließen die Kontinente und tauschen unter anderem mit den Ozeanen Wasser aus. Von Neben- oder Randmeeren ist zum Beispiel die Rede, wenn sie durch Inselketten vom Hauptmeer getrennt sind oder sich am Rand von Kontinenten befinden. Alle Meere sind miteinander verbunden. Auch wenn Nord- und Ostsee das Wort „See“ im Namen tragen, sind sie Meere – und sprachlich korrekt kann man also weiterhin „ans Meer fahren“. Allerdings gibt es auch „Meere“, die nur so heißen, eigentlich aber Seen sind.

Was ist ein See?
Seen sind Binnengewässer ohne direkte Verbindung zu den Ozeanen. Von einem See aus könntet ihr also nicht direkt auf ein Meer fahren. Ein Wasseraustausch findet lediglich über Verdunstung und Niederschlag statt. So gesehen müsste das Kaspische Meer „Kaspischer See“ heißen und auch das Tote Meer ist lediglich ein See. Gleiches gilt für das Steinhuder Meer in Niedersachsen und das Ewige Meer in Ostfriesland. Nichts als Seen.
Schon gewusst?
Der Meerrettich erhielt seinen Namen, weil er über das Meer nach Europa gebracht wurde.
Wie kommt das Salz ins Meer?
 Salze gibt es im Gestein auf der ganzen Welt. Auch in den Meeren findet sich Salz, das wir als Speisesalz oder Kochsalz kennen und auch in der Küche verwenden. Das Kochsalz löst sich im Wasser sehr gut auf und auch kleine Mengen geraten somit durch die Flüsse ins Meer.
Salze gibt es im Gestein auf der ganzen Welt. Auch in den Meeren findet sich Salz, das wir als Speisesalz oder Kochsalz kennen und auch in der Küche verwenden. Das Kochsalz löst sich im Wasser sehr gut auf und auch kleine Mengen geraten somit durch die Flüsse ins Meer.
Durch den Wasserkreislauf gelangt viel Wasser in die Meere. Es kann ein aber Meer nur durch Verdunstung wieder verlassen. Dabei geht das Salz nicht mit. Salz, das einmal im Meer ist, bleibt also dort. Je mehr Wasser verdunstet, desto salzhaltiger wird das Meer. Deshalb ist auch der Salzgehalt nicht in jedem Meer genau gleich hoch.
Meist enthält ein Liter Meerwasser etwa 35 Gramm Salz – das sind etwa eineinhalb gehäufte Esslöffel voll. In eine Badewanne füllen wir meist etwa 150 Liter Wasser. Man müsste also etwa fünf Kilogramm Salz zugeben, um Meerwasser zu erhalten.
DER OZEAN ALS ENERGIEQUELLE
 Rund ein Drittel des weltweiten Erdöl- und Erdgasbedarfs wird aus dem Meer gewonnen. Experten schätzen, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch um einiges ansteigen wird, denn die Ozeane bergen enorme Vorräte. Allerdings sind die meisten der Ölvorkommen im Flachwasser bereits weitgehend ausgeschöpft, sodass die Ölkonzerne in immer größere Meerestiefen vordringen müssen.
Rund ein Drittel des weltweiten Erdöl- und Erdgasbedarfs wird aus dem Meer gewonnen. Experten schätzen, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch um einiges ansteigen wird, denn die Ozeane bergen enorme Vorräte. Allerdings sind die meisten der Ölvorkommen im Flachwasser bereits weitgehend ausgeschöpft, sodass die Ölkonzerne in immer größere Meerestiefen vordringen müssen.
Diese Bohrarbeiten bedeuten viel Stress und auch Gefahr für die Meeresbewohner. Die Arbeiten unter Wasser sind nämlich mit viel Lärm verbunden und können unter anderem bei Delfinen und Walen zu erheblichen Gehörschäden führen. Das ist fatal für die Meeresbewohner, die sich mittels ihrer akustischen Wahrnehmung orientieren und auf die Suche nach Nahrung gehen. Doch auch andere Meerestiere werden von dem Geräuschpegel stark beeinflusst. So haben Forscher herausgefunden, dass Fische unter Lärmeinfluss anfangen, schädliche und ungenießbare Dinge zu fressen. Bei Strandkrabben, die dem steten Schraubengeräusch von vorbeifahrenden Schiffen ausgesetzt sind, wurden deutliche Symptome für erhöhten Stress nachgewiesen.
4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen jährlich in die Meere. Das entspricht einer Lastwagenladung pro Minute.
DIE SIEBEN WELTMEERE
In historischen Zusammenhängen wird immer wieder von den sieben Weltmeeren gesprochen. Dies bezeichnet die in früheren Zeiten für den Seehandel wichtigsten Gewässer. Zu ihnen gehören neben drei der bereits genannten Ozeane (Pazifik, Atlantik und Indik) auch die vier Mittelmeere: das Arktische Mittelmeer, das Amerikanische Mittelmeer, bestehend aus dem Karibischen Meer und dem Golf von Mexiko, sowie das Australasiatische und das Europäische Mittelmeer.

EIN NEUER OZEAN ENTSTEHT
Die drei Ozeane werden aber nicht für immer alleine bleiben: Zwischen Afrika und Vorderasien reißt ein Graben auf, der sich mit einer Geschwindigkeit von zwei Zentimetern pro Jahr öffnet. Forscher meinen, am Afar-Dreieck im Roten Meer die Entstehung eines neuen Ozeans beobachten zu können. Dort herrschen die gleichen Bedingungen wie vor 200 Millionen Jahren bei der Entstehung des Atlantiks. Bis sich dort jedoch ein neues Ozeanbecken gebildet hat, werden aber wohl noch einige Millionen Jahre vergehen.
Quellen: pixabay.com, pxhere.com, hallimasch-und-mollymauk.de, kabeleinsdoku.de, klexikon.zum.de, 3.hhu.de/biodidaktik, planet-schule.de, weltderphysik.de
Foto: pxhere.com


 Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sollte aber nicht mit einer Allergie verwechselt werden, denn hier spielen zwei unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Eine Unverträglichkeit ist nicht gefährlich, aber sie macht den betroffenen Kindern das Leben oft sehr schwer.
Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sollte aber nicht mit einer Allergie verwechselt werden, denn hier spielen zwei unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Eine Unverträglichkeit ist nicht gefährlich, aber sie macht den betroffenen Kindern das Leben oft sehr schwer. Erdbeeren, Kuhmilch, Weizen, Tomaten, Nüsse und Hühnereier – eines haben diese Nahrungsmittel gemeinsam: Sie können allergische Reaktionen auslösen.
Erdbeeren, Kuhmilch, Weizen, Tomaten, Nüsse und Hühnereier – eines haben diese Nahrungsmittel gemeinsam: Sie können allergische Reaktionen auslösen. 
 Meine Geschichte
Meine Geschichte Steckbrief
Steckbrief Was machst Du, damit Du Deine Sportarten weiterverfolgen kannst? Inwiefern trainierst Du dafür? Welche Hilfsmittel beziehst Du noch und kannst Du einige empfehlen?
Was machst Du, damit Du Deine Sportarten weiterverfolgen kannst? Inwiefern trainierst Du dafür? Welche Hilfsmittel beziehst Du noch und kannst Du einige empfehlen?

 3.) Kräftigung des nicht betroffenen Beines
3.) Kräftigung des nicht betroffenen Beines Steckbrief
Steckbrief Interview mit Tanja Mairhofer
Interview mit Tanja Mairhofer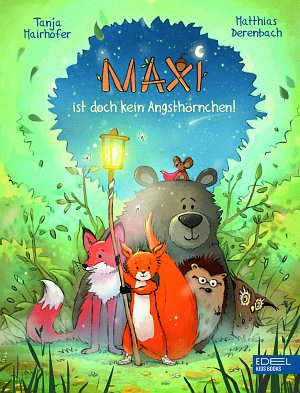 Gab es denn ein persönliches Ereignis, das Sie zu diesem Buchthema bewogen hat?
Gab es denn ein persönliches Ereignis, das Sie zu diesem Buchthema bewogen hat? Das Magazin Momo ist für Eltern und Kinder, die besonders sind. Es soll nicht nur Mut machen, sondern auch eine Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Betroffene Eltern für Eltern!
Das Magazin Momo ist für Eltern und Kinder, die besonders sind. Es soll nicht nur Mut machen, sondern auch eine Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Betroffene Eltern für Eltern!


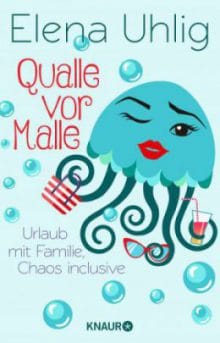
 Inklusion ist alles
Inklusion ist alles Während Tessa den neuen Wombat Solo benutzt und für uns getestet hat, hatte sie stets die volle Kontrolle: Sie konnte alleine ein- und aussteigen und mit den Griffen unter dem Sitz die Höhe, Neigung und die Drehfunktion des Stuhls selbst verstellen. Darüber hinaus hat sie der Stuhl genau in die richtige Position gebracht und ihr die Unterstützung gegeben, um alle Aufgabe in der Küche entspannt zu meistern.
Während Tessa den neuen Wombat Solo benutzt und für uns getestet hat, hatte sie stets die volle Kontrolle: Sie konnte alleine ein- und aussteigen und mit den Griffen unter dem Sitz die Höhe, Neigung und die Drehfunktion des Stuhls selbst verstellen. Darüber hinaus hat sie der Stuhl genau in die richtige Position gebracht und ihr die Unterstützung gegeben, um alle Aufgabe in der Küche entspannt zu meistern. Tessa war so begeistert vom Wombat Solo, dass sie uns im Anschluss fragte, ob sie ihn behalten darf, weil er so bequem ist und alles mitmacht, was sie will.
Tessa war so begeistert vom Wombat Solo, dass sie uns im Anschluss fragte, ob sie ihn behalten darf, weil er so bequem ist und alles mitmacht, was sie will. Medienkonsum: Kinderärzte schlagen Alarm
Medienkonsum: Kinderärzte schlagen Alarm Legasthenie/Lese-Rechtschreib-Störung – jeden Tag eine neue Überwindung
Legasthenie/Lese-Rechtschreib-Störung – jeden Tag eine neue Überwindung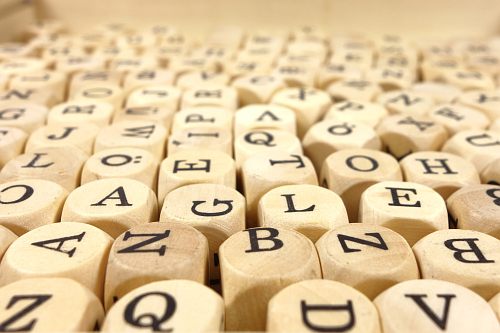
 Kleiner Star auf Rollschuhen
Kleiner Star auf Rollschuhen